Viele Tankanzeigen sind eher „Schätzeisen“, was nicht an den Anzeigeinstrumenten liegt, sondern an der meist sehr simplen Konstruktion der Geber. Der klassische Geber kommt aus dem Automobilbereich und besteht aus einer kleinen Widerstandsplatine, an deren Widerstandswicklungen winklig ein Schwimmer angehängt ist. Nun schaukelt ein Schiff ja viel mehr als ein Auto, was zu häufigen Defekten eben dieser Tankanzeigen führt, denn die dünnen Widerstandsdrähte sind schlichtweg durchgerubbelt.
Wenn die Tankuhr also nur noch „voll“ oder nur noch „leer“ anzeigt … muss gemessen werden!
Zuerst wird am Tankgeber gemessen, das heißt in der Regel den Tank zu suchen – Polster und Matratzenauflagen entfernen. Ist der Tankgeber sichtbar, kann der erste Versuch sein, die bordseitige Messleitung abzuziehen oder -zuschrauben und ein Multimeter an die beiden Kontakte des Gebers anzuschließen. Das Multimeter auf Widerstandsmessung stellen (Ohm) und die Anzeige prüfen. Es sollte ein Wert zwischen grob 35 und 190 Ohm angezeigt werden, keinesfalls aber unendlich (OL).
Zweite Prüfung: Den Tankgeber ausbauen – aber vorher mit einem Edding die Position des Geberflansches zum Tank markieren. Das Gefummel mit den asymmetrischen Flanschen wollen wir uns lieber ersparen. Wenn der Tankgeber ausgebaut ist, muss bei einer Lageänderung des Schwimmers auch die Ohmzahl variieren. Die technischen Daten von Tankgebern sind nach EU Norm / VDO im Widerstandsbereich von 0 Ohm (leer) -190 Ohm (voll) und bei US Fahrzeugen ist der Standard 33 Ohm (voll) – 240 Ohm (leer). Natürlich muss das Anzeigeinstrument zu diesem Widerstandsbereich passen!
Tut sie das nicht, muss ein neuer Geber her. Die „old-style“ Automobil- Hebelgeber würde ich immer durch Axial-Schwimmergeber ersetzen (für Wasser bzw. Treibstoff), für Fäkalientanks empfehle ich Ultraschallgeber.
Fehler können auch durch eine schlechte Minusleitung vom Geber zum Instrument herrühren – das wäre das weitere Vorgehen, wenn der Schwimmer in Ordnung ist. Man prüfe den Durchgang mit dem Multimeter zwischen der meist mittleren Geberleitung zum Instrument (Klemme G, S, Send) und auch die Minusverbindung vom Geber (manchmal ist es auch der Geberflansch!) zum Minus des Instrumentes. Faule Installateure sparen sich auch mal eine Zwillingsleitung vom Instrument-Minus und verkabeln nur das Geberplus, was dazu führt, daß sich der Geber sein Minus von wo ganz anders (und damit gestört) herholt. Alle Kontakte und Kontaktflächen sollten blank und sauber sein, ggf. Kabelschuhe und Ringkabelschuhe neu pressen und das Kabel auf Korrosion prüfen.
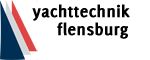
Neueste Kommentare